winzige werkzeuge für eine absurde welt Niels Boeing, Dezember 2000, aktualisiert März 2004 |
|
|
Die Kreativität hat die Welt der Atome erreicht: Nanotechniker fertigen Bausteine für winzige Computer oder neue Materialien, einige träumen sogar davon, das Leben nachzubauen. Dabei bedienen sie sich inzwischen einiger Nano-Werkzeuge, die in unserer Welt keine Entsprechung haben. Wie greifen, trennen, verbinden und transportieren Nanotechniker ihre Materialien? „Mikroskope“ zu Greifarmen |
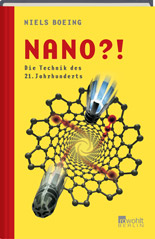
Für alle, die es noch genauer wissen wollen: Dieses "Extended Remix" ist seit 19. März im Buchhandel. Infos unter nano.bitfaction.com. |
|
Vor über 100 Jahren stieß Max Planck das Tor zur Welt der Atome und Elementarteilchen einen ersten Spaltbreit auf: Seine Quantentheorie ließ erahnen, dass diese Sphäre neuen, verblüffenden Gesetzen unterliegt. Heute sind Forscher und Techniker rund um den Erdball mit diesen Gesetzen so vertraut, dass sie den „Nanokosmos“ zu manipulieren, ja ganz neu zu gestalten beginnen. Sie bauen Fußbälle mit einem Durchmesser von nur einem Nanometer – einem Milliardstel Meter – oder fertigen Inschriften aus einzelnen Atomen an. Noch 1959 – da hatte Plancks zur Quantenmechanik weiterentwickelte Theorie immerhin schon Kernkraftwerke und Atombomben-Abwürfe möglich gemacht – hatte der amerikanische Physiker Richard Feynman geklagt: „Bis jetzt müssen wir die atomaren Strukturen hinnehmen, die die Natur uns vorsetzt.“ Und hinzugefügt: „Aber im Prinzip wäre es für den Physiker möglich, jede Substanz zu synthetisieren, die ihm der Chemiker hinschreibt.“ Feynmans berühmter Vortrag „There ’s plenty of room at the bottom“ (die Rede steht im Original unter: www.its.caltech.edu/~feynman/plenty.html) gilt heute als Startschuss zur technischen Eroberung der Welt der Atome und Moleküle. Den Begriff Nanotechnik kreierte dann 1974 der Japaner Norio Taniguchi. Feynmans Vortrag hätte als Kuriosität der Wissenschaftsgeschichte in Vergessenheit geraten können, ja selbst der Preis von 1000 Dollar, den er für die erste auf einen Stecknadelkopf geschriebene Buchseite aussetzte – der übrigens schon 1964 eingelöst wurde. Doch mehrere Entwicklungen beflügelten den Vorstoß in den Nanokosmos derart, dass er sich heute zu einem kaum zu überschauenden Forschungsgebiet ausgewachsen hat. Jede Vision braucht ihre Werkzeuge. Feynmans hatte zunächst keine. Die entscheidenden beiden Nano-Tools entwickelten Forscher im Schweizer IBM-Labor Rüschlikon (www.zurich.ibm.com): Das Raster-Tunnel-Mikroskop 1982, das seinen Erfindern Gerd Binnig und Heinrich Rohrer schon vier Jahre später den Nobelpreis einbrachte (www.nobel.se/physics/laureates/1986/index.html), und das Atom-Kraft-Mikroskop 1986, woran Binnig ebenfalls maßgeblich beteiligt war. Während Elektronenmikroskope davor nur unter bestimmten Umständen atomare Ausmaße auflösen konnten, lieferten die neuen Sonden derart exakte Bilder auch von Festkörperoberflächen. „Das Prinzip des Kraft-Mikroskops erinnert ja sehr an einen normalen Plattenspieler. Dass das mit Mechanik besser funktioniert als mit einem Elektronenmikroskop, war schon erstaunlich“, erinnert sich Binnig. Doch der Begriff „Mikroskop“ trügt. Mit diesen Nanosonden lässt sich die atomare Welt nicht nur sichtbar machen, sondern auch formen. „Rastersonden-Mikroskope sind das Interface zwischen uns und der Nanowelt“, sagt Harald Fuchs, Physiker an der Uni Münster und Leiter des dortigen Center for Nanotechnology, CeNTech (www.centech.de). Dies fördert eine der verwirrendsten Eigenschaften der Quantenphysik zu Tage: Jede Beobachtung ist eine Manipulation des beobachteten Objekts. Wer den Impuls etwa eines Helium-Atoms misst, tritt in eine Wechselwirkung mit diesem und verändert so dessen ursprünglichen Zustand. In den Rastersonden-Mikroskopen offenbaren sich Schauen und Manipulieren als zwei Seiten einer Medaille: der Kontakt der ultrafeinen Mikroskop-Spitze mit einem Atom kann beides bewirken. Die Enge der Informationsgesellschaft als Motivation Dass die Technisierung der Nanowelt so rasant fortschreitet, liegt längst nicht mehr an purer wissenschaftlicher Neugier, die Feynman noch als zentrales Motiv gesehen hatte. Es ist vor allem die Entwicklung der Informationsgesellschaft, deren Datenmassen explodieren und dennoch immer schneller verarbeitet werden müssen. Weil Information nur in Verbindung mit realen Speichern und Prozessoren existiert, führt das über kurz oder lang zu einem gewaltigen Platzproblem. Die heutigen, auf Silizium basierenden Chips können mit einigen technischen Kniffen noch bis etwa 2012 im jetzigen Tempo geschrumpft werden. Doch bei etwa 40 bis 50 Nanometer Breite der Leiterbahnen ist Schluss. Dann schlägt ein quantenmechanischer Störeffekt zu: Elektronen „durchtunneln“ die Trennschichten in den Transistoren, die Leiterbahnen werden quasi kurzgeschlossen. Der Ausweg könnten Nano-Chips sein, die statt Silizium diverse Kohlenstoffverbindungen nutzen – alle nicht breiter als wenige Nanometer. Erste molekulare Elektronik-Bauteile sind bereits im Labor erzeugt worden: Ein Transistor aus winzigen Kohlenstoff-Röhrchen mit einem Durchmesser von 1 Nanometer. Physiker aus dem niederländischen Delft konnten solche Röhrchen in einen für Transistoren unerlässlichen Metall-Halbleiter-Kontakt verwandeln. Denn die „Nano-Tubes“, wie diese 1991 in einem japanischen Labor entdeckte Spielart des Kohlenstoffs auch genannt wird, können beides sein. Knickt man sie in der Mitte, erhält man eine metallische und eine halbleitende Hälfte. Cees Dekker, der das Delfter Team leitet (www.mb.tn.tudelft.nl), hält eine kommerzielle Produktion solcher Röhrchen-Transistoren aber noch für „weit weg“. Auch mit Fullerenen, jenen 1985 entdeckten kugelförmigen Kohlenstoff-Molekülen, ist bereits experimentiert worden. Eine Forschergruppe aus dem kalifornischen Berkeley konnte in diesem Jahr das „Fußball-Molekül“ C60 – die C-Atome sind hier zu Fünf- und Sechsecken wie die Lederflicken eines Fußballs angeordnet – eingekeilt zwischen Goldelektroden in einen Ein-Elektronen-Transistor verwandeln. Inzwischen sind eine Reihe größerer organischer Molekülgruppen bekannt, die als elektrische Gleichrichter, als Leiterbahn oder als Datenspeicher funktionieren könnten. Um 1 Bit zu speichern, ist theoretisch nur noch 1 Molekül nötig. Daraus gefertigte Molekular-Festplatten würden die Speicherdichte heutiger Festplatten um ein Vielfaches übertreffen. Eine Nano-Speichertechnik, die mechanisch arbeitet, haben IBM-Forscher um Gerd Binnig entwickelt. Ihr „Millipede“ besteht aus einem Raster von 1024 Hebelärmchen eines Kraftmikroskops. Ihre Spitzen drücken nun in eine weiche Polymerschicht ein Loch, wenn ein Bit geschrieben werden soll. Zum Auslesen von Bits tastet der Millipede eine bereits gelochte Oberfläche ab. Fällt ein Hebelchen in ein Bitloch, verändert sich seine Temperatur und damit sein elektrischer Widerstand, was messbar ist. Damit werden Speicherdichten von bis zu 80 Gigabit pro Quadratzentimeter möglich (verglichen mit einer Spitzenspeicherdichte von 8 GB/cm2 bei heutigen Festplatten). In drei Jahren will IBM einen Millipede mit 4000 Kraftspitzen fertig gestellt haben, der in einer neuen Generation von Handys eingesetzt werden könnte. Es sei ohne weiteres vorstellbar, auch „Wafer (Silikatscheiben, Anmerkung von nbo) mit Millionen Hebelarmen zu strukturieren“, so Binnig. „Thermodynamik“ statt Fließbandarbeit Will man mit derart winzigen Systemen mehr als einen Nanoeffekt erzielen, muss man sie aber meist zu größeren Systemen bündeln. „Um einen funktionierenden Quantenpunktlaser zu bauen, müssen Sie bis zu 200 Milliarden Nanostrukturen pro Quadratzentimeter erzeugen, und das in kürzester Zeit“, sagt Dieter Bimberg, Physiker an der TU Berlin und Sprecher des Kompetenzzentrums Nan-Op (www.nanop.de). Hier Quantenpunkt für Quantenpunkt – eine wenige Nanometer große Pyramide aus Halbleiteratomen, in der ein Elektron eingeschlossen ist – mit einem Kraftmikroskop aufzuschichten, würde die Lebenszeit eines Menschen übersteigen. „Da ist massive Parallelität erforderlich“, so Bimberg. Die erreicht man mit einem in der Natur bewährten Verfahren: der Selbstorganisation. Das Prinzip dahinter ist simpel: Alle physikalischen Systeme streben mit der Zeit ins thermodynamische Gleichgewicht. Dieses so einzustellen, dass die gewünschten Produkte entstehen, ist nun die Arbeit eines Nanotechnikers. Lässt man zum Beispiel einen Halbleiterkristall unter berechneten physikalischen Bedingungen auf einer Oberfläche mit anderem Abstand zwischen den einzelnen Atomen aufwachsen, zerfällt der in viele fast identische Inseln, wenn die Kristallschicht eine gewisse Dicke überschreitet. Man erhält mit einem Schlag viele Quantenpunkte. Auch Chemiker interessieren sich brennend für Nanotechnik. Wenn sich molekulare Strukturen in Nanometer-Abmessungen erzeugen und analysieren lassen, werden völlig neue Werkstoffe möglich. Goldklumpen taugen an sich unter Raumtemperatur nicht als Katalysator für chemische Reaktionen – 3 bis 5 Nanometer große Goldteilchen dagegen sehr wohl. Eine japanische Firma hat aus diesem Effekt inzwischen ein Produkt gemacht. Ihr „Odor Eater“ (zu Deutsch: Gestankfresser) zerlegt mit Hilfe des Nanogoldes Moleküle aus Toiletten-Dünsten. Nanotechnische Katalysatoren könnten auch der Verschwendung vorbeugen. „Rund 20 Prozent des Rohöls bleiben ungenutzt, da die heutigen Cracker in Raffinerien nicht effektiv arbeiten“, sagt Markus Antonietti vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm (www.mpikg-golm.mpg.de). Dort arbeiten er und andere Forscher an neuen keramischen Zylindern, die von nanometergroßen Poren durchzogen sind und nur ein einziges Molekül fassen. Triebe man nun das Rohöl durch diesen Katalysator, könnte keine Molekül-Kette mehr dem Schicksal entgehen, geknackt zu werden, wie dies in großen Behältern der Fall ist. Nanotechnik ist, was Werkstoffe angeht, keine Vision mehr“, bekräftigt Rüdiger Nass, Chemiker und Mitgründer von Nanogate in Saarbrücken (www.nanogate.de), einem der weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet. Nanodünne Schichten, die durchsichtig sind und trotzdem elektrisch leitend, die nicht zerkratzbar sind oder keinen Schmutz aufnehmen (der so genannte Lotus-Effekt), sind ebenso reguläre Produkte wie Nanopulver. „Ohne Nanopulver gäbe es keine Chips wie den Athlon von AMD oder Intels Pentium“, sagt Nass. Beim Chemical Mechanical Polishing wird der Silizium-Wafer, aus dem später die Prozessoren herausgeschnitten werden, vor jedem Beschichtungsschritt mit einem derartigen Pulver aus Schwefeljodid poliert. Die hierin enthaltenen Nanopartikel haben 2003 allerdings zu einer hitzigen Debatte über Umwelt- und Gesundheitsrisiken geführt (siehe auch "Déjà Vu: die neue Nanotech-Debatte"). Selbst Metalllegierungen können mittels Nanotechnik optimiert werden. So entdeckte man in Schwertern aus dem frühen Mittelalter nanometerfeine Kohlenstoff-Strukturen, die den Klingenrand zu Stahl härteten. Was damals ein Zufallsprodukt von Hammer und Amboss war, wird nun zum Gegenstand eines ganz neuen, computergestützten Werkstoff-Designs. Der entscheidende Unterschied zwischen Hammer und Nanowerkzeug Natürlich sind Nanowerkzeuge ohne Computer unbrauchbar. Damit markieren sie das Ende einer langen Entwicklung in der Geschichte der Technik. Jahrtausendelang war der Effekt eines Werkzeugs unmittelbar fühlbar, weil man im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegen musste – beim Hämmern, Sägen, Schrauben oder am Flaschenzug – später zumindest sichtbar, wie bei der Dampfmaschine oder mit Abstrichen bei Elektrogeräten. Die Eingeweide des Kosmos – Atome und Moleküle – sind dagegen keinem unserer Sinne zugänglich. Alles, was in dieser Sphäre geschieht, müssen wir uns von Rechnern in verständliche Bilder übersetzen lassen. „Es kommt zu einer Hybridisierung von kognitiven und manipulierenden Techniken“, charakterisiert der Philosoph und Techniktheoretiker Walter Christoph Zimmerli die neue Phase. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, ebenfalls ein Objekt von Nano-Dimensionen, war vor allem eine Computerleistung. Wenn aber die winzige reale Welt ohnehin erst in „kognitiven Geräten“ erzeugt werden muss, kann man sie damit natürlich auch simulieren. „Das könnte einen radikalen Einschnitt in der Geschichte der Technik bedeuten, der dazu beitragen könnte, die negativen Folgen einer neuen Technologie weiter zu minimieren – ja: vielleicht sogar ihren GAU von vornherein auszuschließen“, so Zimmerli. Die Nano-Apokalypse hat schon ihre Propheten Ihren hypothetischen GAU hat die Nanotechnik längst: das Problem des grauen Schleims („grey goo problem“). Das ist allerdings dem biologisch inspirierten Nano-Zweig um den Amerikaner Eric Drexler zuzuschreiben. Dessen Vision von Nanotechnik, 1981 erstmals in einem wissenschaftlichen Paper veröffentlicht und 1986 in dem Buch „Engines of Creation“ (www.foresight.org/EOC/) weiter ausgeführt, konzentriert sich auf molekülgroße Roboter, die zum Beispiel Krebszellen im menschlichen Körper vernichten und sich selbst reproduzieren können. Schon bald wurde spekuliert, was passiert, wenn solche Nano-Bots außer Kontrolle geraten: Im schlimmsten Fall würden sie sämtliches Leben auf der Erde in seine molekularen Bausteine zerlegen, um Kopien ihrer selbst erzeugen zu können, die dann als gewaltiger grauer Schleim den Globus bedeckten (s.a. eine Abschätzung möglicher Grey-Goo-Szenarien von Robert Freitas: www.foresight.org/NanoRev/Ecophagy.html). Unter anderem dies veranlasste den US-Software-Entwickler Bill Joy, Mitschöpfer der universellen Programmiersprache Java, im Digitalmagazin „Wired“ im April dieses Jahres, zu einem partiellen Forschungsverzicht in der Nanotechnik aufzurufen ("Warum die Zukunft uns nicht braucht"). Seitdem liefern sich Apokalyptiker und Nano-Optimisten wie Ralph Merkle oder Ray Kurzweil eine heftige, mehr von den Medien als von den Forschern selbst ernst genommene Debatte über Fluch und Segen der neuen Technik. Unerreichbares Vorbild: das reale Leben Die ist von der hiesigen Nano-Szene eher mit Verwunderung aufgenommen worden. Einig ist man sich mit Drexlers Lager nur darin, dass das irdische Leben die bisher eindrucksvollste Nanotechnik hervorgebracht hat. Und das nicht nur in solch offensichtlichen Gebilden wie der Zellprotein-Maschine Ribosom oder dem Replikationssystem DNS. „Unser Gehör ist in der Lage, Schwingungsamplituden von wenigen Atomdurchmessern wahrzunehmen – das ist Nanotechnik par excellence“, sagt Harald Fuchs vom Münsteraner CeNTech. Etliche Nanoforscher weisen darauf hin, dass bislang keine halbwegs realistischen Konzepte für die Fortbewegung, Energiezufuhr oder Informationsverarbeitung von Nano-Bots vorliegen. Auch der Entdecker der Fullerene – jener Kohlenstoff-Molekülbälle –, der US-Chemiker und Nobelpreisträger Richard Smalley, wiegelt ab (www.nobel.se/chemistry/laureates/1996/). Die Konzepte selbstreplizierender Nano-Bots ließen „ein tiefer gehendes Verständnis von Chemie vermissen“. Harald Fuchs zweifelt darüber hinaus, ob der Ansatz einer permanent gesteigerten Miniaturisierung von Drexler und Kurzweil überhaupt wesentlich für den Fortschritt in der Nanotechnik ist. Möglich sei, dass so viel wichtigere neue Prinzipien, die nur in der Nano-Dimension nutzbar sind, übersehen werden. „Hätte man vor 150 Jahren mit einer ähnlichen Fixiertheit auf das Vorhandene Lampen verbessern wollen, hätten wir heute Hightech-Kerzen, aber keinen Laser.“
die wichtigsten nano-werkzeuge im überblick: Greifen Der Werkzeugkasten des Nanotechnikers besteht aus einer Reihe von Mikroskopen, deren wichtigste das Rastertunnelmikroskop (STM) und das Atomkraftmikroskop (AFM) sind. Beide arbeiten mit einer wenige Atome dicken Spitze aus Gold, Wolfram oder Nickel und können nicht nur Bilder aus dem Nanokosmos erzeugen, sondern auch Atome bewegen. Beim AFM befindet sich die Spitze am Ende eines winzigen Hebelarms. Bringt man sie dicht an die Oberflächen-Atome heran, beginnt die so genannte zwischenmolekulare Van-der-Waals-Kraft auf den Hebel zu wirken: abstoßend bei kleinen, anziehend bei mittleren Abständen (in Mulden oder Zwischenräumen). Der dabei auf- und abschwingende Hebelarm reflektiert einen Laserstrahl in unterschiedlichen Winkeln, was sich wiederum in ein Oberflächenprofil umrechnen lässt. Beim STM wird ein quantenmechanisch bedingter „Tunnelstrom“ zwischen Spitze und Oberfläche des Objekts gemessen. Dessen Höhe hängt vom Abstand der beiden ab. So lässt sich Zeile für Zeile abscannen und ein Oberflächenprofil errechnen. Die berühmte Unschärferelation der Quantenmechanik – nach der man Ort und Impuls nie gleich exakt messen kann – beeinträchtigt die maximale Auflösung kaum: Sie liegt in der Senkrechten zwischen einem Hundertstel und einem Tausendstel Nanometer. Die seitliche Genauigkeit liegt bei einem Zehntel Nanometer. Die Spitzen können nun aber auch so hart auf das Objekt gedrückt werden, dass sich Atome verlagern. Legt man eine Spannung an die STM-Spitze an, kann das daraus resultierende elektrische Feld auch Atome aus der Oberfläche herausziehen und an der Spitze festhalten. Anschließend bugsiert man sie an die gewünschte Position. Die beiden Nano-Tools sind inzwischen in sehr unterschiedlichen Preisklassen erhältlich. Während Geräte für Vakuumexperimente mit einer Viertelmillion Mark zu Buche schlagen, können interessierte Laien Rastersonden schon ab 14 000 Mark kaufen. „Das Komplizierteste daran ist noch der Computer“, sagt Franz Gießibl, Physiker aus Augsburg und Nanowissenschafts-Preis- träger 2000. Einige Modelle passen sogar ins Reisegepäck. Das Easyscan der Schweizer Firma Nanosurf beispielsweise ist nicht größer als tragbarer CD-Player. Trennen In der Sphäre der Atome wird nichts mehr herausgeschnitten, zermahlen oder gesägt. Das sind grobschlächtige Operationen aus dem Makrokosmos, die im „Top-Down“-Verfahren aus großen Festkörpern kleine machen und dabei Abfall produzieren. Beim Sägen von Holz etwa werden pro Gramm Sägemehl Trilliarden von Cellulose-Molekülen weggeworfen. Dies findet allenfalls noch in der Mikrosystemtechnik eine Entsprechung. Hier werden aus Siliziumblöcken Formen geätzt, die noch einige 1000-mal größer sind als Kohlenstoff-Nanoröhrchen: Zahnräder, Pumpen und andere Teile von Mikromaschinen. Mit Nanotechnik hat dies nichts zu tun. Deren Bereich beginnt erst bei Strukturgrößen unter 100 Nanometern. Allerdings hat es Versuche gegeben, mit kurzen Stromstößen aus Rastersonden einzelne Atome herauszulösen. Verbinden Schon ein Tröpfchen Klebstoff oder eine kleine Schweißnaht enthalten ungeheure Mengen an Atomen, ganz zu schweigen von einer Kelle Mörtel zwischen Ziegeln. Nano-Bausteine – also Atome und Moleküle – werden dagegen durch chemische Verbindungen zusammengehalten. Das können entweder Elektronenwolken sein, aber auch die elektrostatische Anziehungskraft gegensätzlich geladener Atome. Störend kann eine andere Wechselwirkung sein: die Van-der-Waals-Kraft, für die es in der makroskopischen Welt keine Entsprechung gibt. Sie ist zwar recht schwach, kann aber Atome oder Moleküle bis zu einem gewissen Grade zusammenhalten – auch solche, die man gar nicht zusammenhaben will. Am ehesten könnte man sie mit dem jederzeit ablösbaren Kleber von Post-it-Notizzetteln vergleichen. Transportieren Hundertfünfzig-spurige Schnellstraßen könnten noch durch unsere feinsten Blutgefäße gebaut werden.“ Diese Vision Eric Drexlers eines neuen Medikamenten-Verteilsystems setzt eines voraus: funktionierende Nanotransporter. Die wären auch für den Zusammenbau anderer dreidimensionaler Nanostrukturen unerlässlich – hier reicht das Selbstorganisationsprinzip wie bei der Herstellung von zweidimensionalen Schichten nicht mehr. Inzwischen sind einige Mechanismen vorgeschlagen und in Ansätzen sogar experimentell angegangen worden. Zwei von ihnen arbeiten mit einem „Baustellenboden“, der von hauchfeinen Furchen durchzogen wird. In einem Modell lagert man in diesen Moleküle des Proteins Kinesin an. Diese könnten dann große Frachtmoleküle samt Ladung entlang der Furchen weiterreichen – in Umkehrung eines natürlichen Transportprozesses in Zellen, bei dem Kinesin selbst entlang der so genannten Mikrotubuli wandert und Chemikalien befördert. Ein anderes kürzlich vorgestelltes Computermodell israelischer Forscher will dagegen „Nano-Raupen“ bauen. Diese bestünden aus drei parallelen Molekülen, jeweils durch eine Art Feder zusammengehalten und der Länge nach in einer Furche platziert. Führt man der ersten Feder Energie zu, schnellt sie auseinander und schiebt das erste Molekül einen Graben weiter. Dieser Vorgang würde dann beliebig oft wiederholt. Andere Konzepte setzen auf rotierende Moleküle wie ATP-ase, die Nano-Fähren wie ein Propeller antreiben sollen. Auch hier stand die Natur Pate: Kommt das an der Zellmembran befestigte Enzym ATP-ase mit dem Molekül ATP in Berührung, wandelt es dieses in ADP um, nimmt dabei Energie auf – und beginnt zu rotieren. Auf der jüngsten Konferenz des von Nano-Guru Eric Drexler geleiteten Foresight-Instituts wurden gar Propeller vorgeschlagen, deren Rotorblätter durch „Schwanzschläge“ von befestigten Geißeltierchen angetrieben würden. Als Container sind verschiedene größere Moleküle mit Hohlräumen denkbar, etwa die Fullerene, jene kugelartigen Kohlenstoffmoleküle wie der „Nano-Fußball“ C60 oder Käfige aus langen organischen Molekülen, so genannten Peptiden. Erschienen im Dezember 2000 in der Woche. Weitere Links und Informationen zur Nanotechnik gibt es auf der Website zum Buch Nano?! Die Technik des 21. Jahrhunderts von nbo, nano.bitfaction.com |
|